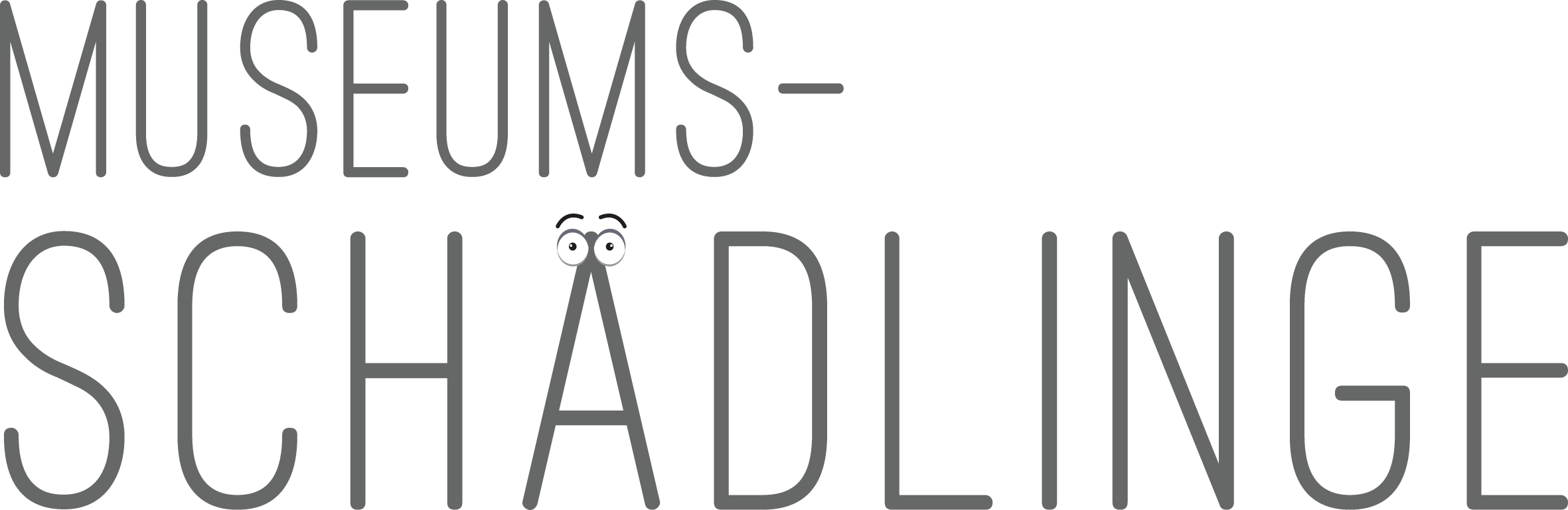Pelzmotte
Textilschädling in Museen, Freilichtmuseen und historischen Gebäuden

Pelzmotte Tinea pellionella
Biologie Männliche Pelzmotten erreichen eine Flügelspannweite von 9 bis 13 Millimetern, während die Weibchen mit 11 bis 17 Millimeter durchschnittlich etwas größer sind. Auf den lehmgelben Vorderflügeln befinden sich meist drei dunkle Punkte, von denen zwei aber auch fehlen können. Sowohl die Falter und auch Raupen können leicht mit verwandten Arten verwechselt werden. Daher ist die Identifizierung der Imagines meist nur nach Präparation der Genitialien möglich. Die Lebensdauer der weiblichen Pelzmotten beträgt ca. 30 Tage. In diesem Zeitraum können sie ungefähr 100 Eier einzeln oder in kleinen Gruppen am Brutsubstrat ablegen. Die Entwicklung der Larven verläuft über 33 bis 90 Tage mit 5 bis 11 Larvenstadien. Entwicklungsdauer vom Ei bis zum Falter kann unter günstigen Bedingungen 1,5 bis 4 Monate betragen. In der Regel bildet die Pelzmotte aber pro Jahr zwei Generationen in Mitteleuropa aus.
Lebensweise Ursprünglich stammt die Pelzmotte vermutlich aus Europa, wo sie gemäßigte und relativ kühle mediterrane Gebiete besiedelte. Die Verpuppung erfolgt in der schützenden Larvenröhre, nachdem beide Enden der Röhre zuvor von der Larve mit Spinndrüsensekret verschlossen wurden. Die Larve trägt die selbst gebaute Gespinströhre mit sich herum, was sie von der Kleidermotte unterscheidet. Bereiche mit hoher Luftfeuchte werden bevorzugt.
Schäden Die Larven ernähren sich vor allem von trockenen, keratinhaltigen Substanzen tierischer Herkunft, wie an Wollstoffen, Polstermöbeln, Teppichen, Leder, Haaren, Pelzen oder Federn. Mit
Nahrungsmittelresten, Schweiß oder Urin verschmutzte Textilien werden bevorzugt befallen. Unter Umständen können auch Mischgewebe aus synthetischen Fasern und Wolle angefressen werden. In Museen sind neben Textilien auch wissenschaftliche Präparate von Säugetieren und Vögeln in Sammlungen gefährdet. Die Pelzmotte verursacht in Mitteleuropa geringere Schäden als die Kleidermotte.
| Monitoring | ||
| Falter | Larven, Kokons | |
| Klebefallen, Pheromonfallen | Sichtkontrolle | |
| Biologische Gegenspieler | ||
| Erzwespen Baryscapus tineivorus | Zwergwespen Trichogramma evanescens |
Literatur
Pospischil R (2020) Motten als Materialschädlinge. DpS 10, S. 15-17
Pospischil R. (2006) Die Pelzmotte Tinea pellionella. DpS 11, S. 12-13